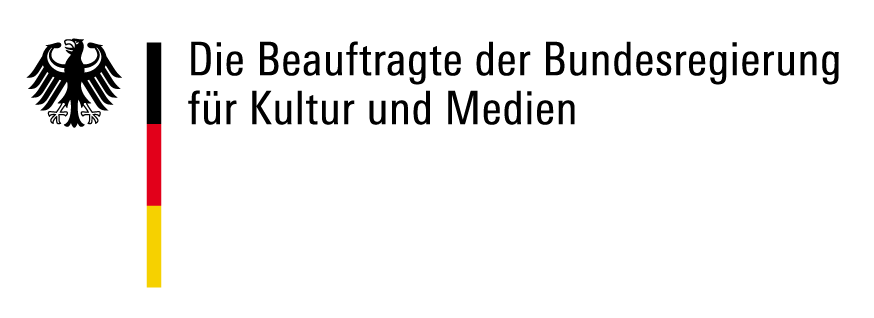FFT Düsseldorf
The Year 2017
A Collective Chronicle of Thoughts and Observations
Welcome to what is going to be a collective chronicle of the year 2017! This journal will follow the general change that we experience in our daily lives, in our cities, countries and beyond, in the political discourses and in our reflections on the role of artists and intellectuals. Originating from several talks and discussions with fellow artists and thinkers FFT feels the strong need to share thoughts and feelings about how we witness what is going on in the world. Week after week different writers, artists, thinkers and scientists will take the role of an observer as they contribute to this collective diary.
#21: 22. – 28. Mai
Veit Sprenger
Montag, 22. Mai
Ich brauche dringend Geld. Steuerschulden in ungeahnter Höhe, verbunden mit einer amtlichen Sanktion wegen verspäteter Abgabe von Unterlagen aus dem vergangenen Jahrzehnt, haben mein ohnehin labiles finanzielles Gleichgewicht so stark zur Soll-Seite verschoben, dass das Schiff meines Lebens Wasser aufnimmt. Mit Ende Vierzig ist es mir und meiner Generation nicht gelungen, im Kulturestablishment einen Posten mit Festgehalt zu ergattern. Das liegt zum einen an der freiberuflichen Arroganz, mit der wir uns schmücken, zum anderen an der mangelnden Seriosität, die wir lange Zeit als Markenzeichen vor uns her getragen haben. Als Klassenclowns des Kulturbetriebs sind wir zwar überall gern gesehene Gäste, aber zu Klassensprechern sind wir damit nicht prädestiniert.·Ich bin nicht traurig darüber, aber mein Geldbeutel ist es, weshalb ich mich gezwungen sehe, jenseits meines eigentlichen Berufs vorübergehend nach zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten Ausschau zu halten. Während der vergangenen Wochen habe ich also die dafür vorgesehenen Plattformen besucht und mich bei der Suche vorzugsweise auf Angebote konzentriert, die sich mit Argumenten wie „6000 Euro pro Woche von zu Hause aus verdienen!“ meiner Aufmerksamkeit empfahlen. Letztlich habe ich mich bei dieser Recherche aber in einem Dschungel aus Pop-Up Fenstern verirrt, bis Anfang vergangener Woche mein Rechner von einer Krankheit befallen wurde, die ihn für die Internet-Suche und eigentlich fast alle anderen Aufgaben unbrauchbar gemacht hat.
Trost fand ich heute morgen in einem handschriftlichen Aushang am Eingang eines vierstöckigen Bürogebäudes in der Annenstraße. „Arbeit für Idioten hier klingeln“, stand darauf, und natürlich klingelte ich, nicht weil ich mich angesprochen fühlte, sondern weil ich mir von Leuten, die solche Aushänge platzieren, zumindest Unterhaltung verspreche. Die Tür summte schon auf, als mein Zeigefinger kaum den Klingelknopf berührte, und ich betrat einen weiß gefliesten Vorraum mit Fahrstuhl. Statt der üblichen Auf-Ab-Knöpfe gibt es neben dem Fahrstuhl nur ein Ziffernfeld mit Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Daneben hängt ein Schild mit einem langen Code, den man eingibt, um die Tür zu öffnen. Im Fahrkorb ist keine weitere Bedienung vorgesehen. Oben öffnet sich die Tür in einen großen, hellen, fast unmöblierten Raum, der eher nach Leerstand als nach Arbeitsplatz aussieht. Der Boden besteht aus braunem Nadelfilz. An der Decke verlaufen zwischen den unverkleideten Stützträgern Kabel und Lüftungsrohre. Hinten links öffnet sich ein torförmiger Durchgang, hinten rechts ist aus Europaletten eine Art Sitzlandschaft auf vier Ebenen aufgebaut. Darauf saßen wie für ein Foto arrangiert vier Leute, die etwas beredeten. Eine Frau mit unglaublich vielen Haaren, die auf dem untersten Podest saß, dem Fahrstuhl am nächsten, bemerkte mich als erste und sagte „Hallo“, wie zu einem alten Bekannten, der mal wieder reinschaut. Da sahen mich auch die drei anderen an, und ein Mann mit rundem Kopf und Halbglatze winkte mich näher.
Es gab noch zwei weitere Frauen in der Gruppe, eine ganz junge, die als einzige lächelte, und eine mit einem Laptop auf den Knien und einem Blick, der nach übertrieben gespieltem Erstaunen aussah. Ich stellte mich vor und sagte, dass ich unten den Zettel gelesen hätte. Ich wurde aufgefordert mich zu setzen. Ich hatte Hemmungen, mich in dieses Tableau hineinzubegeben und setzte mich deshalb nicht auf die Podesterie, sondern auf den Boden davor, wie in einen Zuschauerraum. Der Mann mit dem runden Kopf nickte lange und nachdenklich, ohne zu sprechen, als wäre gerade etwas Folgenschweres passiert, das er erst einmal geistig verarbeiten musste. Ich wartete auf Fragen zu meiner Person, aber es kamen keine. Scheinbar erschien den Anwesenden die Tatsache, dass ich auf dem Boden Platz genommen hatte, schon so ungewöhnlich, dass ich sie nicht mit weiteren Extravaganzen schockieren wollte. Deshalb wartete ich ab. Im Nachhinein schätze ich unter Berücksichtigung der peinlichkeitsbedingten subjektiven Zeitdehnung, dass etwa sechs Minuten des Schweigens vergingen. Danach hielt ich es nicht mehr aus. Als ich aufstand und Anstalten machte zu gehen, ergriff die Frau mit dem Laptop das Wort.
„Bevor du uns verlässt – brauchst du Geld?“ fragte sie.
„Ja. Ehrlich gesagt, deshalb bin ich hier“, sagte ich.
Ohne ein weiteres Wort wühlten alle die Hände in ihre Hosentaschen und holten Bündel zerknitterter Scheine heraus. Sie strichen sie glatt, betrachteten sie von allen Seiten wie nie gesehene Gegenstände, ordneten sie nach Größe, Farbe und Muster, oder auch nach ganz anderen, nicht nachvollziehbaren Kriterien, nahmen dann einen Teil davon und warfen ihn in die Mitte. Es entstand ein Haufen, der durch seine ungebündelte Luftigkeit sicher nach mehr Geld aussah als er enthielt. Die junge Lächelnde griff den Haufen mit beiden Händen, knüllte ihn zu einer Papierkugel zusammen und übergab ihn mir.
„Danke für heute“, sagte sie. „Wenn du Lust hast, komm morgen wieder, dann gibt es vielleicht noch welches.“
„Welches“. Das erinnert mich an meine Dresdener Freunde Harriet und Peter, die immer erzählen, wie zu DDR-Zeiten mit Geld umgegangen wurde. Es lag einfach irgendwo in der Wohnung herum, bestenfalls in der Schublade des Küchentischs, meistens aber frei zugänglich auf dem Regal, im Bett, auf der Ablage in der Diele oder in einem Schuh. Wenn jemand etwas kaufen wollte, fragte er: „Habt ihr Geld?“ und die Antwort war: „Glaub schon. Schau mal da und da, vielleicht ist da welches.“
Unten zählte ich nach und stellte fest, dass ich für einen zehnminütigen Einsatz dreihundertfünfzehn Euro in kleinen Scheinen in Händen hielt. Ich ging einkaufen und ließ einen Straßenakkordeonisten mit fünf Euro an meiner Freude teilhaben. Es ist eine undankbare Situation, denke ich, als Künstler von der momentanen Laune seiner Mitmenschen abhängig zu sein. Auf jeden Fall werde ich morgen wieder arbeiten gehen.
Dienstag, 23. Mai
In letzter Zeit schlafe ich schlecht. Das Einschlafen ist kein Problem, aber meistens schrecke ich schon um halb drei Uhr nachts wieder hoch. Danach ist es mit dem Schlaf vorbei. Mein Gehirn nutzt die Zeit, um mich mit wilden Gedanken zu beschicken wie ein quengelndes Kleinkind. Die Zeit bis vier Uhr vergeht schnell, dann quäle ich mich durch langweilige Stunden des Wartens, bis meine Bäckerei um sechs öffnet. So war das auch heute Morgen, und weil ich schon um halb sieben rasiert, gewaschen, angezogen und gefrühstückt im Freien stand, ging ich zur Annenstraße, ohne zu erwarten, dass sich um diese Uhrzeit jemand dort aufhalten würde. Der Aushang beim Eingang war weg. Entweder ist das alles nur ein Gag gelangweilter Hedonisten, dachte ich, oder die Firma unbekannten Namens hat in mir tatsächlich den erhofften neuen Mitarbeiter gefunden.
Im Nadelfilzraum war niemand, aber von hinten hörte ich Geschirr klappern. Hinter dem torförmigen Durchgang fand ich einen kleinen Flur mit einer Notausgangstür, durch deren rundes Fenster ich eine Feuerleiter sah. In die Ecke zwischen Durchgang und Tür ist eine Teeküche gequetscht. Die Frau mit dem Laptop war beim Spülen. Ich nahm ein Geschirrtuch, und sie gab mir ohne Begrüßung eine Tasse in die Hand.
„Arbeitsteiligkeit“, sagte ich. Dieses Wort spielt eine Rolle in meiner Branche. Die Verteilung von Aufgaben an darauf spezialisierte Personen ist in der Performancepraxis eigentlich verpönt. Trotzdem lässt sie sich nicht immer vermeiden. Wenn wir nicht aktiv dagegen angehen, stellt sie sich ganz automatisch ein. In diesem Fall scheint das Entropie-Gesetz, wonach jedes System einem Zustand größtmöglicher Unordnung zustrebt, nicht zu greifen. Aber die Frau mit dem Laptop verband mit dem Wort offenbar nichts, denn sie zeigte keine Reaktion.
„Was produziert ihr eigentlich?“ fragte ich. „Ich meine, was tut ihr?“
„Wen meinst du mit ihr?“
„Dich. Euch. Eure Firma.“
„Das ist eine gute Frage“, sagte sie. „Am liebsten würden wir nichts tun. Aber uns fehlt die Kraft dazu. Sagen wir: wir produzieren nicht nichts.“
Jemand im Nadelfilzraum schrie: „Fertig!“ Ich glaube es war die junge Lächelnde. Der Mann mit dem runden Kopf schaute um die Ecke und sang: „Hallöchen!“ Gute Laune, schlecht inszeniert. Trotzdem war ich erleichtert, mit der Frau mit dem Laptop nicht mehr allein zu sein. Ich hatte die anderen gar nicht hereinkommen hören und fragte mich, wo sie auf einmal herkamen.
Der Mann mit dem runden Kopf hatte unser kurzes Gespräch scheinbar mitgehört, denn er merkte an: „Du musst nicht denken, dass hier irgendetwas von dir erwartet wird. Bei uns wird niemand eingestellt. Die Leute kommen, wenn sie kommen, und gehen, wenn sie gehen. Wir sprechen auch keine Kündigungen aus. Manche bleiben länger weg, oder für immer. Das war es dann. Aber wenn du kommst, bewirbst du dich jedes Mal neu. Nicht bei uns, sondern bei dir selbst.“
Der letzte Satz berührte mich unangenehm. „Ich weiß nicht, ob ich mich selbst als Chef haben möchte“, sagte ich.
Der Mann mit dem runden Kopf lachte. Die junge Lächelnde stand jetzt auch im engen Flur und sagte: „Wir produzieren Energie. Weißt du, wieviel Energie ein Mensch im Ruhezustand umsetzt? Ganz schön viel. Wir sind lauter Kraftwerke.“
„Aber darum geht es nicht,“ sagte die Frau mit dem Laptop. „Das ist ein Hilfsargument. Wir haben bestimmte Regeln, die allerdings nicht bindend sind. Sie können jederzeit abgeschafft, variiert oder in ihr Gegenteil verkehrt werden. Wir entwickeln ein Gespür für die Erfordernisse des Tages und versuchen, ihnen gerecht zu werden, zusammen oder jede für sich.“
„Bist du bereit, uns etwas zu zeigen?“ fragte der Mann mit dem runden Kopf.
„Du musst das nicht“, sagte die junge Lächelnde. „Du musst gar nichts. Aber wir freuen uns, dass es dich gibt, und wir wollen dich mit dir feiern. Das können wir besser, wenn du uns etwas von dir zeigst.“
„Was denn?“, fragte ich.
„Falsche Frage“, antwortete die Frau mit dem Laptop. Auf der Feuerleiter vor dem Notausgang sah ich jetzt auch die Frau mit den vielen Haaren, die rauchte. „Du wirst mit ein paar Leuten zusammentreffen, die du noch nicht kennst. Wir sagen dir nicht, ob sie sich wie du zum ersten Mal hier vorstellen, oder ob sie schon lange bei uns sind, ob sie beliebt oder unbeliebt sind, und welche Leistungen sie erbringen. Wir wollen, dass du dir ein Bild von ihnen machst und sie anschließend für uns evaluierst.“
Der Ton hatte sich abrupt geändert. Ich war irritiert und fand das alles etwas überhastet. Die Frau mit dem Laptop nahm mir das Geschirrtuch weg, trocknete sich die Hände daran ab und warf es auf die Spüle. Dann führte sie mich zu einer rostroten Kunststofftür gegenüber dem Notausgang, auf die jemand mit einem Filzstift „Florian“ geschrieben hatte. Sie stieß die Tür auf und trat zur Seite, als Zeichen, dass ich hinein gehen sollte. Der Raum, den ich betrat, ist nur etwa halb so groß wie der Nadelfilzraum, aber immer noch ziemlich groß. Der Bodenbelag ist herausgerissen, und man sieht den nackten Estrich mit Resten von Teppichkleber. Durch die Fensterfront rechts der Tür schien die Maisonne herein. Eines der Fenster stand offen. Eine Taube ging nervös im Raum hin und her. Ihre Füße erzeugten zarte Geräusche auf dem Beton. Wenn Vögel Angst haben, machen sie sich glatt wie Fische. Die Tür schloss sich hinter mir. Tatsächlich war außer mir und der Taube nur ein Mensch im Raum, ein großer, schlaksiger Typ im Anzug, mit sympathischem Gesicht. Ich ging davon aus, dass das Florian war. Die Taube hielt ich für eine Zufallsbekanntschaft, die vor kurzem zum Fenster hereingeflogen war.
Florian legte den Zeigefinger auf die Lippen. Vielleicht wollte er das Tier nicht durch menschliche Gespräche zusätzlich ängstigen. Ich sah mich kurz um. Der Raum war leer, bis auf einen Stuhl, fünf Blumentöpfe mit Kräutern und einen Servierwagen aus Edelstahl. Auf dem Servierwagen standen ein zylinderförmiger Dampfwärmer, der mit Hot Dog-Würstchen gefüllt war, ein Tablett mit Milchbrötchen und zwei Schüsseln mit Gurkenscheiben und Röstzwiebeln, außerdem ein geöffnetes Senfglas, in dem ein Löffel steckte und je eine große Quetschflasche mit Ketchup und Mayonnaise. Die Taube interessierte sich für die Nahrungsmittel, war aber noch unentschlossen, ob sie ihr Angstprogramm zu Gunsten der Futteraufnahme beenden sollte. Beides gleichzeitig ging wohl nicht. Florian schlich in großen Kreisen um sie herum, ob mit Jagd- oder Rettungsabsichten blieb zunächst unklar. Die Taube hielt immer den gleichen Abstand zu ihm, wobei sie jeweils den Punkt im Raum wählte, der zugleich dem Futter am nächsten und am weitesten entfernt von Florian war. Ein entsprechend programmierter Roboter hätte die Pfade nicht exakter ausführen können als sie. Florian blieb stehen. Ebenso die Taube. Florian ging. Ebenso die Taube. Ich verhielt mich ruhig, weil ich das System nicht als zusätzliche Variable unnötig verkomplizieren wollte. Statt dessen stellte ich mir die Muster vor, die die beiden auf dem Boden hinterlassen würden, wenn man ihre Wege nachzeichnete. Das Bild ging allerdings in Chaos auf, als Florian in einer überraschenden Diagonale durch den Raum grätschte und dabei in den Servierwagen rannte, der scheppernd umfiel, so dass Würstchen und Brötchen in weitem Radius durch den Raum rollten. Die Taube verließ trotz der ungehindert auf sie zurollenden Nahrung mit panischem Geflatter durch das offene Fenster den Raum. Kaum im Freien, wurde ihr Flug ruhiger und natürlicher, als hätte sie das Ereignis schon vergessen.
Florian und ich waren jetzt auf uns selbst gestellt. Ich frage mich, ob wir in irgendeiner Weise beobachtet wurden. Es gibt jedenfalls keine Kameras oder ähnliches im Raum. Ich fing an, das herumliegende Zeug einzusammeln. Florian half mir. Wir sammelten Gurken, Zwiebeln und Würstchen und legten sie in ihre Behälter zurück. Alles war verdreckt und mit Taubenflaum bedeckt. Es war ekelhaft. Aber formal war nach zehn Minuten der Ausgangszustand wieder hergestellt. Unsere Hände waren klebrig, und wir sahen uns vergeblich nach einer Reinigungsmöglichkeit um. Da trat Florian dicht vor mich hin und strich in großzügiger Geste Vorder- und Rückseite seiner Hände erst abwärts, dann aufwärts an meinem Hemd ab. Ich nahm das Senfglas und verlieh ihm einen Orden für seine Tat, in Gestalt eines daumennagelgroßen Senfkleckses auf das Revers seines Jacketts. Er ließ es geschehen, nahm mir dann das Glas aus der Hand und dekorierte mich in gleicher Art, wobei er den Löffel noch etwas kreisen ließ, um meinen Senforden zu perfekter Rundheit zu verteilen. So ging das eine Zeit lang hin und her, bis unsere Oberkörper von Orden strotzten. Wir gingen jetzt zur Ausschmückung unserer Uniformen über. Unter Zuhilfenahme von Ketchup und Mayonnaise, die ich direkt aus den Flaschen drückte, malte ich Florian eine dreifarbige Kokarde, und er verzierte meinen Ordensbehang mit Schützenschnüren und Portepees. Die innere Logik des Vorgangs war unwiderstehlich. Wäre ein Außenstehender dazu gekommen und in unsere Tätigkeit eingestiegen, wir hätten ihn vermutlich vor Empörung über diese Anmaßung zum Fenster hinaus geschmissen. So ist das mit Recht und Ordnung.
Wir sahen einstweilen unsere Aufgabe als erledigt an. Wir waren auch schon einigermaßen erschöpft, obwohl es erst Viertel nach neun war. Deshalb verließen wir den Raum und suchten auf der ganzen Etage nach unseren Mitarbeitern, aber außer uns war niemand mehr da. Immerhin entdeckten wir am Stirnende des kleinen Flures einen weiteren Raum, eine Art Fundus, in dem auf knapp zwanzig Quadratmetern bis unter die Decke Schuhe, Stoffe und Kleidungsstücke in großen Tragetaschen lagerten. Auf einem Garderobentisch lag ein Couvert, darin waren tausend Euro in Fünfzigern und ein Zettel:
„Für Reinigung, Honorar und Spesen. Bitte behaltet etwas übrig, ihr werdet es morgen brauchen.“
Wir teilten das Geld und verließen unseren Arbeitsplatz. Die Begegnung mit der Frau mit dem Laptop und den anderen war seltsam. Aber ich mag Florian, obwohl wir noch kaum ein Wort miteinander geredet haben. Ich ging nach Hause, um zu duschen. Ich habe es ja nicht weit. Leider hat sich vorgestern meine Waschmaschine nach 18 Jahren Dienst im Schleudergang mit einem lauten Knall verabschiedet. Deshalb trug ich die Wäsche zum „Waschsalon 115“ am Rosenthaler Platz. Er ist an ein Café angegliedert, wo sie gerne auch größere Scheine wechseln.
Mittwoch, 24. Mai
Heute bin ich erst um halb elf zur Arbeit gegangen. Im Nadelfilzraum war niemand. Vorsichtshalber schaute ich hinter die Podesterie, fand dort aber nur einen Kugelschreiber und eine selbst gedrehte, ungerauchte Zigarette. Jenseits des Durchgangs pfiff jemand „Waterloo“. Ich folgte der Melodie. Im Taubenraum fand ich Florian, der sich mit den Topfpflanzen beschäftigte und Kaugummi kaute.
„Komm rein“, sagte er.
„War lustig gestern“, sagte ich.
„Ja“, sagte er.
„Hast du gewaschen?“ fragte ich.
„Ja“, sagte er.
„Ich auch.“
Florian nahm seinen Kaugummi aus dem Mund, rollte ihn zu einem Stäbchen, bohrte den Zeigefinger bis zum Ansatz in die feuchte Torferde einer der Pflanzen und schob den Kaugummistab hinein. Dann verschloss er das Loch mit Daumen und Zeigefinger, drückte die Erde fest und goss aus einer Flasche etwas Mineralwasser nach. Die Kohlensäure schäumte auf dem Torf. Er knipste ein Blatt ab und gab es mir zum Probieren. Es war Salbei, der ein bisschen nach Multivitaminsaft schmeckte.
„Und, schmeckt es dir?“ fragte er.
„Nein“, sagte ich.
„Ist meine Erfindung“, sagte er. „Verbrauchte Geschmacksträger werden recycelt und in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt.“
„Du kannst Kaugummi nicht in den natürlichen Kreislauf zurückführen“, sagte ich. „Er ist aus Erdöl gemacht.“
„Erdöl ist auch Natur,“ sagte er.
„Warum kombinierst du nicht einfach Salbei mit Minze?“ fragte ich. „Oder mit echtem Obst, statt der Aromen?“
„Dann wäre es kein Recycling“, sagte er.
Ich wollte dem Gespräch eine andere Wendung geben und fragte ihn, wie er hier her gekommen sei. Er sagte, die Firma gehöre seinem Vater und er solle sie einmal übernehmen. Deshalb sei er in einem dreimonatigen Praktikum hier tätig, bevor er an der technischen Universität sein Betriebswirtschaftsstudium antrete. Kurz danach widerrief er seine Behauptung. Scheinbar wollte er mir nichts weiter erzählen, und ich bestand nicht darauf. Die Mittagssonne prallte herein, und es wurde immer wärmer im Raum.
„Wo sind die anderen?“ fragte ich.
„Wer?“ fragte er zurück.
„Die Frau mit dem Laptop, der Mann mit dem runden Kopf und so weiter?“
„Nicht hier.“
„Das sehe ich.“
„Ich bin jetzt schon den dritten Tag hier, ohne etwas zu essen oder zu trinken“, sagte er.
„Moment, ich denke du warst waschen“, sagte ich. „Gibt es hier eine Maschine?“
„Nein“, sagte er.
Ich zeigte auf die Flasche. „Und hier steht Mineralwasser.“
„Stimmt“, sagte er und trank die Flasche leer. Gestern kam er mir so nett vor, heute fand ich ihn langweilig und plump. „Lass uns Geld suchen gehen“, sagte er.
Mir erschien es anmaßend, so kurz nach meiner Ankunft schon wieder Geld zu erhoffen, ich folgte ihm aber, weil ich mich in dem überhitzten Raum und bei dem dummen Gespräch nicht mehr wohl fühlte. Wir fanden die Frau mit dem Laptop, den Mann mit dem runden Kopf, die junge Lächelnde und die Frau mit den vielen Haaren im Fundus. Einige der Kleidertaschen waren ausgeleert worden. Die Kleidungsstücke waren ringförmig zu fünf Nestern zusammengeschoben, jedes Nest etwa eineinhalb Meter im Durchmesser. An den Außenseiten bildeten Hosen, Hemden und T-Shirts einen wulstförmigen Ring, in der Mitte waren die Nester überwiegend mit Pullovern aus Wolle und Kaschmir ausgepolstert. Hier und da ragte ein Ärmel oder ein Hosenbein in den Raum, aber alles in allem waren die Nester sehr ordentlich, sogar akribisch gebaut, wie eigentlich nur Tiere sie bauen können, indem sie über Tage scheinbar planlos immer wieder an ihrem Werk herumzupfen, bis sich nichts mehr zum Zupfen anbietet. In den Nestern saßen oder lagen überwiegend nackt unsere vier Arbeitgeber, ohne sich zu rühren. Die Frau mit den vielen Haaren forderte uns auf, die Tür zu schließen, es sei kalt. Als Florian sie fragte, was hier stattfände, sagte sie:
„Wir brüten.“
„Was brütet ihr denn aus?“ fragte Florian.
Die Frau mit den vielen Haaren zeigte auf das Nest ganz vorne bei der Tür, das einzige, das nicht besetzt war. Darin lagen dicht gruppiert fünf weiße Hühnereier. Bei zwei Eiern war der rote Haltbarkeitsaufdruck zu sehen.
„Kann ich mitbrüten?“ fragte Florian.
„So einfach ist das nicht“, sagte Die Frau mit dem Laptop. „Dafür musst du einundzwanzig Tage hier liegen und Körperwärme abgeben. Ich empfehle dir, von Anfang an eine Stellung zu suchen, in der du es aushältst. Viel bewegen kannst du dich nicht dabei, sonst zerbrechen die Eier. Probier es am besten erstmal ohne Eier aus. Übe einundzwanzig Tage in der einen, einundzwanzig Tage in einer anderen Position. Wenn du die ideale Haltung herausgefunden hast, kannst du anfangen.
„Ich glaube nicht, dass ihr mit diesen Eiern Erfolg haben werdet“, sagte ich. „Das sind doch Supermarkteier, die sind gar nicht befruchtet.“
„Hältst du uns für blöd?“ fragte die Frau mit den vielen Haaren. Sie ist am ganzen Körper tätowiert, aber nicht mit einem durchgestalteten Großmotiv, wie das jetzt immer häufiger gemacht wird, sondern mit einem Stückwerk verschiedenster Motive und Stile, die sich zu einem wilden Puzzle zusammenfügen.
„Das ist nur eine Übung, bevor wir es mit befruchteten Eiern versuchen“, sagte die junge Lächelnde freundlicher. „Aber vielleicht habt ihr Lust, uns welche zu besorgen. Wir können hier nicht weg.“
Wir verließen das Büro und sahen auf meinem Smartphone nach, wo in Berlin befruchtete Hühnereier zu beziehen sind. Zufällig landeten wir auf der Seite einer Zoohandlung in Zehlendorf, die auf Reptilien spezialisiert ist und mit Brutkästen wirbt. Geld hatten wir noch genügend. Wir nahmen uns also ein Taxi und kauften im Terraristik-Zentrum Oliver Paap je ein Gelege von Schildkröten-, Kornnattern-, Madagaskar-Taggecko- und Kaimanen-Eiern. Der Einkauf fraß mehr als dreihundert Euro unseres Budgets. Wir aßen noch eine Currywurst an einem Straßenstand auf dem Walther-Schreiber-Platz und fuhren dann zurück nach Mitte. Der Fahrer war ein Akzelerationist. Wenn eine Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte er, dass es uns in die Sitze drückte, um hundert Meter weiter an der nächsten roten Ampel so scharf zu bremsen, dass die Gurte einrasteten. Aus Angst um die Eier baten wir um einen ausgeglicheneren Fahrstil.
Die ganze Aktion dauerte mehr als drei Stunden. Florian ist ein Trödler. Er braucht für alles doppelt so lang wie andere Menschen. Allein das Bezahlen im Taxi, mit herunterfallendem Münzgeld, das dann bis auf den letzten Cent im Fußraum wieder zusammengesucht werden musste, bedeutete annähernd den gleichen Zeitaufwand wie die Fahrt selbst. Anschließend stritt er mit mir über den richtigen Weg, obwohl das Geschäft auf der anderen Straßenseite längst in Sichtweite war. Eine Currywurst bestellen, bezahlen und essen könnte ein dreijähriges Kind schneller als er. Aber immerhin hat sich seine Laune gebessert. Seit wir die Firmenräume verlassen hatten, bewegte er sich freier, fast elegant. Im Innenraum scheint er immer den Kopf einzuziehen, um nicht an die Decke zu stoßen. Auf den Fahrten war er gesprächig. Er weiß gut über Bienenzucht Bescheid. Er erzählte mir, dass Bienen eine Art Kilometerzähler haben, mit dem sie die Entfernung zu einem Futterplatz messen können. Diese Entfernung geben sie dann im Bienenstock durch Tanzbewegungen an ihre Schwestern weiter. Liegt der Futterplatz allerdings hinter einer größeren Wasserfläche, zum Beispiel einem breiten Fluss, dann verschätzen sie sich in der Entfernung, weil über dem Wasser ihr Kilometerzähler nicht läuft. Sie brauchen vorbeiziehende Strukturen wie Gräser, Hügel und Bäume, um ihre Geschwindigkeit und damit die Entfernung korrekt bestimmen zu können. Wenn sie Wasser überqueren, erscheint es ihnen, als würden sie sich nicht fortbewegen. Deshalb werden die Bienenschwestern, die im Tanz eigentlich über eine Futterstelle jenseits des Flusses informiert werden sollten, vergeblich das diesseitige Flussufer nach Futter absuchen.
Im Büro fanden wir die Anderen Kaffee trinkend im Flur. Sie hatten ihre Nester verlassen, und der Mann mit dem runden Kopf machte sich daran, aus den unbefruchteten Hühner- und den befruchteten Reptilieneiern in einem teflonbeschichteten Wok ein Omelett zu braten. Ich war verletzt über den achtlosen Umgang mit unserem teuren Einkauf, aber der Mann mit dem runden Kopf schien Skrupel gar nicht in Erwägung zu ziehen. Er spießte ein Stück des Eiergemischs auf eine Gabel, blies kurz und gab es mir dann zum Probieren. Es fehlten Salz und Gewürze. Florian erntete eine Handvoll Aroma-Salbei, zerrupfte ihn und warf ihn in den Wok. Ich wollte Salz zufügen, aber als ich das Salzfass kippte, fiel der Deckel ab, und das ganze Salz ergoss sich in das gerinnende Ei. Gemeinsam versuchten wir, das überschüssige Salz heraus zu löffeln, aber das Omelett war verdorben. Die Frau mit den vielen Haaren fluchte, verließ durch den Notausgang den Flur und zündete sich auf dem oberen Abtritt der Feuerleiter eine Zigarette an. Mein Herz wurde ganz kalt vor Trauer und Entsetzen. Ich bildete mir ein, nicht nur ein Omelett, sondern die gesamte gemeinschaftliche Arbeit von einundzwanzig Tagen verdorben zu haben, und kämpfte mit den Tränen.
Donnerstag, 25. Mai
Ausgerechnet gestern ging es länger bei der Arbeit. Abends musste ich noch den Zug nach Wiesbaden nehmen, um dort meine Mutter abzuholen und mit ihr nach Eberbach-Seltz bei Straßburg weiter zu fahren, wo am heutigen Feiertag die Erstkommunion meines Neffen gefeiert wird. Es war der Wunsch meiner Mutter, von Wiesbaden aus selbst mit dem Auto nach Eberbach zu fahren. Mein Vater ist im Februar gestorben, und da sie jetzt nicht mehr gebunden ist, will sie sich allmählich wieder an längere Autofahrten gewöhnen. Meine Schwester hat ihr ein Navigationsgerät geschenkt, das getestet werden sollte. Die Autobahn war frei und die Navigationsautomatik funktionierte gut. Unaufgefordert berechnete die Maschine in regelmäßigen Abständen die verbleibende Fahrtdauer, um die „verkehrsbedingte neue Ankunftszeit“ durchzusagen, nicht ahnend, dass meine Mutter freiwillig vierzig fuhr. Um halb zwei Uhr nachts kamen wir bei meiner Schwester an und gingen gleich ins Bett.
Heute früh sprachen in der örtlichen Kirche die Kommunionkinder brav ihre Gebete in ein kabelloses Mikrofon, das im Altarraum herumgereicht wurde. Sozusagen über Bande wurden die bekannten Metaphernklaster über „Licht in der Dunkelheit“, „lebendiges Wasser in der Wüste“ und so weiter in die Gemeinde geschickt, deren Mitglieder sich bei dieser Gelegenheit mehr oder weniger gerührt daran erinnerten, wie sie in ihrer eigenen Kindheit mit denselben hohlen Wortgebilden gequält worden sind. Kaum zu glauben, dass sich diese Stilblüten schon seit Jahrtausenden tradieren. Erfunden hat sie König David, der hysterische Harfenspieler, dem es nicht mehr genügte, dass laut Mose „drei Männer zu Abrahams Hütte kamen“. Er wünschte und verfügte, dass ab sofort von Gott und Engeln, Gärten und Palästen, grünen Auen und guten Hirten gesprochen werden sollte und entwarf mit eitler Selbstüberbietung eine neue Glaubenstopographie, in deren Zentrum er sich als Dichter und Deuter wichtig machen konnte. Die Grundlage für das Gleichnis und seine Interpretationen war gelegt, und die Sprache der Anbetung damit für immer verdorben. Folgerichtig auf die Spitze getrieben von der Uneigentlichkeit des Protestantismus, der das Wort vollends seiner tätlichen Magie beraubte, wird die bizarre religiöse Bilderwelt heute ausgerechnet von den marktwirtschaftlichen Gesundbetern denunziert, die nicht begriffen haben, dass sich ihre Ideologie der unerfüllten Versprechungen auf dieses Erbe gründet.
Bei Familienfesten gelten ganz andere Statussymbole als in meiner gewohnten Umgebung – nicht wie weit entfernt das Gastspiel, wie up-to-date die Meinung, wie speziell die Ernährung, sondern wie schön das Haus, wie groß der Garten und wie zahlreich die Kinder. Das sind ja auch alles keine doofen Sachen, und da ich in diesen Disziplinen sowieso kaum mitbieten kann, werde ich arglos empfangen als jemand, der nicht gefürchtet werden muss und daher gemocht werden darf. Was uns zusammenführt, ist natürlich die Angst vor dem Tod. Täglich sterben Leute und werden Leute geboren. Meistens sind es ein- und dieselben. Manche von ihnen sterben mehrmals am Tag, andere sterben nur einmal pro Woche oder sogar nur einmal alle paar Jahre. Das variiert stark und ist deshalb verwirrend. Aber ungewöhnlich ist es nicht. Dennoch haben wir alle das dringende Bedürfnis, einander zu versichern, dass sich nichts geändert hat und niemals etwas ändern wird.
Freitag, 26. Mai
Seit heute Nachmittag bin ich wieder in Berlin. Im Briefkasten fand ich ein Couvert ohne Absender mit der Aufschrift „Veit“. Darin waren zwei Fünfziger, vier Zwanziger und zwei Zehner, völlig verknittert. Falls das Geld von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Firma stammt, wovon ich ausgehe, ist es sicher wieder nach der Hosentaschenmethode gesammelt worden. Ich wundere mich, dass meine Adresse bekannt ist. Bisher habe ich mich nur mit meinem Vornamen vorgestellt. Einen Arbeitsvertrag oder etwas ähnliches gibt es nicht. Ich bin mit der Firma auch nie in schriftlichen oder telefonischen Austausch getreten. Die Post ist mir unangenehm. Sie scheint mir zwei Dinge mitteilen zu wollen, erstens: „Wir wissen, wo du wohnst“, und zweitens: „Du schuldest uns etwas.“ Mein Abgang am Mittwoch hat meine Stimmung getrübt, und während meiner kurzen Reise habe ich darüber nachgedacht, ob ich überhaupt in die Firma zurückkehren soll. Arbeitsverhältnisse ohne ausformulierte Verbindlichkeiten erzeugen immer ein Ungleichgewicht, bei dem irgendjemand benachteiligt wird. „Zahle was du willst“, „arbeite wie du kannst“ – solche Arrangements vernebeln die tatsächlichen Verhältnisse, die letztendlich doch immer auf Zwang hinauslaufen, in diesem Fall sogar auf eine metaphysische Kontrolle durch eine schweigende, unsichtbare, und damit gott-ähnliche Instanz.
Aber vielleicht übertreibe ich. Vielleicht haben die Kollegen ihrerseits ein schlechtes Gewissen, weil wir vorgestern nicht im Guten auseinandergegangen sind und deuten mein gestriges unangekündigtes Fernbleiben als ein Signal, das sie in Zugzwang bringt. Möglicherweise hätten sie sogar Recht damit, denn obwohl ich mich natürlich auf die Option des freien Kommens und Gehens berufen könnte, wäre es doch feiner gewesen, zumindest ein Wort über meine Pläne zu sagen und so Missdeutungen meiner Abwesenheit zu vermeiden. Ich beschloss deshalb um kurz vor sechs, doch noch in der Firma vorbeizuschauen, wenn nicht um zu arbeiten, dann um meine ersten Arbeitstage zu bilanzieren und gegebenenfalls meinen Einsatz in der kommenden Woche zu besprechen.
Von meinem Haus muss ich nur knapp zweihundert Meter die Heinrich-Heine-Straße bis zur Kreuzung mit der Annenstraße hinunterlaufen. Unterwegs dachte ich an meine Vorfreude Anfang der Woche, als ich den gleichen Weg zurücklegte, um arbeiten zu gehen. Jetzt, da ich kein unbeschriebenes Blatt mehr bin und sich erste Verbindungen, Erinnerungen und Erwartungen eingestellt haben, ist die Freude der Sorge gewichen. Eine Routine wird sich unter diesen Voraussetzungen wohl kaum einstellen. Genau diese wäre aber für einen Geldjob eigentlich wünschenswert. Statt dessen bin ich schon nach wenigen Tagen ganz und gar in die Verantwortung genommen, ohne aber zu wissen, worin diese Verantwortung eigentlich besteht.
Im Erdgeschoss lagerte vor dem Fahrstuhl ein Mann auf einem speckigen blauen Schlafsack. Sein Lager war so zerwühlt, dass nicht zu erkennen war, wo der Schlafsack endete und seine Kleidung begann. Es sah aus, als wäre er mit den Stoffen verwachsen und müsste diese als schmerzende Ausstülpungen seiner Haut mit sich herumschleppen. Es roch nach Urin. Vor ihm Stand ein leerer Kaffeebecher mit ein paar Münzen. Bettler arbeiten rund um die Uhr. Bei ihnen ist die Trennung zwischen Arbeitswelt und Privatleben wirklich aufgehoben. Als sich die Fahrstuhltür öffnete, fiel das grelle Kunstlicht aus dem Fahrkorb auf das Gesicht des Mannes, und er legte ungehalten den Unterarm über die Augen.
Im Nadelfilzraum war niemand, aber offensichtlich war während meiner Abwesenheit gearbeitet worden. Die Podeste in der hinteren Ecke waren abgebaut, zusammengeklappt und Platz sparend an die Rückwand gelehnt worden. Einzelne Platten des Bodenbelags waren herausgenommen, so dass wie im Taubenraum der helle Estrich sichtbar wurde, allerdings nur hier und da als quadratische Aussparungen in der gleichmäßigen braunen Fläche. Manche Quadrate waren mit schwarzem Klebeband kreuzförmig beklebt, wie angekreuzte Kästchen in einem Formular, andere waren blank. Die Klebebandrolle lag noch da. Insgeheim hoffte ich, dass ich niemanden mehr antreffen würde. Ich hob die Klebebandrolle auf und legte sie auf einen Heizkörper, um der Form halber wenigstens noch einmal Hand anzulegen, bevor ich ins Wochenende ging. Ich lauschte, hörte aber nichts außer von draußen das leise Rauschen des Verkehrs. Ich durchquerte den Raum, um mich zu vergewissern, dass das Büro wirklich verlassen war. Ich bewegte mich leise, um mich, falls doch jemand da wäre, zur Not unbemerkt wieder davon machen zu können. Im Flur sah ich, dass im Taubenraum Licht brannte, denn an der Unterseite der Tür war ein schmaler Lichtstreifen sichtbar. Ich öffnete die Tür einen Spalt und sah hinein. Auf der rechten Seite an der Fensterfront standen in einem Abstand von jeweils zwei Metern von vorne nach hinten aufgereiht Florian, der Mann mit dem runden Kopf, die Frau mit dem Laptop und die Frau mit den vielen Haaren. Die Frau mit den vielen Haaren las mit lauter Stimme etwas von einem Zettel ab. Ich erschrak, als mich die junge Lächelnde aus unerwarteter Nähe ansprach. Ich hatte sie nicht gesehen. Sie stand unmittelbar rechts neben der Tür, als würde sie Wache halten, und sagte leise:
„Jetzt bitte nicht.“
Ich entschuldigte mich flüsternd und schloss von außen die Tür. Ich blieb im Halbdunkel des Flurs stehen und lauschte. Ich wunderte mich, dass ich nun wieder nur das Verkehrsrauschen von draußen hörte. Aus dem Raum drang nicht der leiseste Ton. Dass die billige Kunststofftür nicht schalldicht war, wusste ich, denn ich hatte am Mittwoch schon beim Büroeingang Florian pfeifen hören, und sein Pfeifen war sicher nicht lauter gewesen als die Stimme der Frau mit den vielen Haaren. Da ich außerdem verärgert über meinen eilfertigen Rückzug war und mich, obwohl ich noch kurz zuvor nichts lieber getan hätte als unbehelligt nach Hause zu gehen, nun ausgesperrt fühlte, blieb ich stehen. Ich gebe zu, dass ich sogar mein Ohr an die Tür legte, ein Benehmen, das ich mir selbst gar nicht zugetraut hätte. Von innen war nichts zu hören. Ich drückte die Klinke nach unten, hielt sie etwa eine Minute gedrückt und öffnete dann, aber nur wenige Zentimeter, die Tür. Die Bewegung der Tür dürfte kaum zu sehen gewesen sein, wenn nicht jemand bewusst darauf achtete. Jetzt hörte ich wieder die Stimme der Frau mit den vielen Haaren. Die Tür wurde von innen so heftig aufgerissen, dass ich ein Stück in den Raum hinein gezogen wurde. Die junge Lächelnde schaute mich zornig an. Die Frau mit den vielen Haaren unterbrach ihr Vorlesen, drehte sich um, sah mich und schrie:
„Raus!“
Die junge Lächelnde drängte mich hinaus und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Es wurde wieder dunkel. Ich ging also nach Hause. Auch gut, dann komme ich eben nicht mehr. Wenigstens weiß ich jetzt, woran ich bin.
Vor meinem Hauseingang stehen als Zierbegrünung hüfthohe Büsche, mit denen die Hausverwaltung den Wohnwert des Komplexes zu steigern hofft. Zwischen den Büschen verläuft ein Netz schmaler Trampelpfade, auf dem sich die Partytouristen an den Wochenenden in den Bewuchs hineinarbeiten, um einen halbwegs geschützten Ort zum Pissen zu finden. Als ich meinen Hausschlüssel aus der Tasche zog, sah ich von hinten einen, der sich nicht einmal die Mühe gemacht hatte, in die Büsche zu gehen, sondern sich direkt vom Gehsteig aus erleichterte. Der kam mir gerade recht.
„Du bist doch eine Sau!“ schrie ich. „Mach das gefälligst zu Hause! Ich will dich hier nicht mehr sehen!“ Als ich schon das Haus betreten hatte, die Eingangstür aber noch nicht ganz hinter mir zugefallen war, hörte ich, wie er mir nachrief:
„Ich bin hier zu Hause. Ich lebe auf der Straße. Ich will dich hier auch nicht mehr sehen.“
Es ist besser, niemanden anzuschreien. Es trifft immer die falschen.
Samstag, 27. Mai
Als ich aufwachte, sagte der Mann mit dem runden Kopf: „Wenn du schläfst, hörst du manchmal zu atmen auf. Ein paarmal wollte ich dich schon wecken. Er muss doch atmen, habe ich gedacht. Aber dann seufzt du so ganz tief und atmest weiter.“
Er saß auf dem wackeligen Stuhl neben meinem Bett, einer Fehlkonstruktion aus Aluminiumstangen und schwarzem Weichplastik von Ikea, die zum Sitzen gar nicht geeignet ist, und die ich deshalb nur zum Ablegen meiner Kleidung benutze. Den Mann mit dem runden Kopf schien das nicht zu stören. Er saß mit übereinandergeschlagenen Beinen da und hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, meine Kleidungsstücke wegzuräumen. Ich wollte etwas Freundliches antworten, denn schließlich war es aufmerksam von ihm, auf meine Atmung zu achten und sich Sorgen um mich zu machen, aber ich musste dringend aufs Klo. Im Vorbeilaufen sah ich, dass die Frau mit den vielen Haaren es sich im Wohnzimmer in meinem Sessel bequem gemacht hatte. Sie las „Das Heilige und die Gewalt“ von René Girard. Sie war nicht in ihre Lektüre versunken, sondern blätterte im Buch herum wie eine, die mit einem Magazin die Zeit totschlägt. In der Küche saß die junge Lächelnde auf der Fensterbank und schaute hinaus. Die Frau mit dem Laptop beschäftigte sich vorsichtig mit meiner Espressomaschine, als handelte es sich um eine geladene Waffe. Florian saß auf der Kante des Küchenstuhls und zappelte mit den Knien. Als ich aus dem Bad kam, überlegte ich kurz, ob ich nicht wenigstens meine Jeans anziehen sollte, aber der Mann mit dem runden Kopf saß sicher immer noch darauf. Ich schlafe in T-Shirt und Boxershorts. Es ging wohl an, bei dem schönen Wetter so hinauszugehen. Ich verließ also leise die Wohnung und zog die Wohnungstür hinter mir zu. Auf dem Flur war es angenehm kühl. Auf dem Gang und im Fahrstuhl begegnete ich niemandem. Als ich entsprechend meiner Gewohnheit in den Briefkasten sehen wollte, fiel mir ein, dass mein Schlüsselbund oben in der Wohnung am Nagel hing.
Ich hätte gerne gefrühstückt oder wenigstens einen Kaffee getrunken. Aber mein Geldbeutel befand sich in der Tasche der Jeans, auf der der Mann mit dem runden Kopf saß. Wahrscheinlich spürte er ihn als elastische Wölbung unter seinem Hintern. Ich spazierte durch die Brache zwischen Neuer Jakobstraße und Sebastianstraße bis zum Luisenstädter Park. Dort setzte ich mich auf eine Bank, legte einen Arm über die Lehne und versuchte zu entspannen. Es wurde schon ziemlich warm. Der Wetterbericht hat vor Waldbrand gewarnt. Jetzt ärgerte ich mich, dass ich gar nichts aus der Wohnung mitgenommen hatte. Ich überlegte, wie viel Geld noch in meinem Geldbeutel war. Ich habe am Montag gut 300 Euro eingenommen, am Dienstag noch einmal 500, wovon ich allerdings am Mittwoch mehr als die Hälfte für Einkäufe, Taxi und Essen ausgegeben habe, dann noch einmal 200 Euro gestern im Couvert. Davon gehen die Zugfahrten von und nach Wiesbaden, einmal waschen und einmal tanken ab. Ich dürfte mit rund 360 Euro im Plus sein. Das ist nicht berauschend für eine ganze Woche Arbeit. Aber jetzt hätte ich das Geld gut gebrauchen können, vor allem, da für die nächste Zeit keine Einnahmen in Sicht sind. Auf meinem Konto ist auch noch etwas. Ich dachte darüber nach, ob ich doch noch einmal in meine Wohnung zurückkehren sollte. Ich hatte keinen Schlüssel, aber ich könnte klingeln. Sicher hätten sie mich hereingelassen, vermutlich sogar mit Freude. Was ist das Wichtigste? Mein Handy und meine EC-Karte. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich nicht zurückkehre, muss ich die Karte vorsichtshalber sperren lassen. Aber ich habe weder die erforderliche Notrufnummer, noch ein Telefon, um sie zu wählen. Und was soll werden, wenn die Karte einmal gesperrt ist? Wie soll ich an Geld kommen? An welche Adresse soll meine Ersatzkarte gesandt werden? Und so weiter.
Ich ging hinunter zur Prinzenstraße, von dort aus zur Johanniterstraße, und klingelte bei Karl und Marjorie. Sie waren nicht da. Ich spazierte Richtung Hallesches Tor und setzte mich vor dem Amerikahaus auf die Mauer bei den Fahrradständern. Ich mag die Atmosphäre dort. Ich legte mich auf die warme Mauer und döste ein bisschen. Als ich etwa eine Stunde später wieder aufstand, hatte ich Kopfweh und Durst. Ich betrat die Bibliothek, aber dort war es von der Klimaanlage so kalt, dass ich bald fror. Ich klingelte ein zweites Mal bei meinen Freunden. Diesmal waren sie da. Die Kinder empfingen mich mit Grimassen und Geschrei. Normalerweise provoziere ich sie bei meinen Besuchen auf die eine oder andere Weise, deshalb erwarteten sie auch diesmal Scherzkrawall. Aber ich fühlte mich unwohl und hatte Gliederschmerzen, also begrüßte ich sie ernst. Bald zogen sie sich gelangweilt ins Wohnzimmer zurück um zu streiten. Karl hatte ein Olivenbrot gebacken und bot mir davon an. Ich nahm ein Glas aus dem Abtropfgestell und füllte es zweimal mit Leitungswasser. Karl, Marjorie und die drei Kinder wohnen auf knapp fünfzig Quadratmetern. Das ist ohnehin schon etwas beengt. Wenn dann noch Gäste kommen, müssen Tische ausgezogen und Schlafgelegenheiten aufgeklappt werden, brachiale Manöver, die den ganzen kleinen Haushalt in Unordnung bringen, als sei ein Bär zur Tür herein gekommen. Es war erst fünf Uhr nachmittags, aber ein ganzer Tag im Freien schlaucht. Deshalb zog ich mich auf Einladung meiner Freunde gerne ins Arbeitszimmer zurück und legte mich auf das quietschende Klappbett, das dort vorbereitet war. Zwischendurch stand ich auf und schrieb an Karls Computer. Danach ging es mir besser. Ich ging zu den Anderen in die Küche und half bei der Vorbereitung des Abendessens. Wir tranken Tee und aßen das restliche Olivenbrot mit Butter und Räucherkäse, dazu Cocktailtomaten. Hendrik, das mittlere Kind, spielte mit einer Zombie-Fingerpuppe und wies uns auf das Blut hin, das aus Mund und Augen quoll. Darüber vergaß er das Essen und musste in regelmäßigen Abständen daran erinnert werden.
Punkt acht ging ich ins Bett, gleichzeitig mit den Kindern. Ich vermisse mein Handy, in dem auch meine E-Books gespeichert sind. Faulkner hat zuletzt erzählt, wie ein alter Sträfling während der großen Flut von 1927 bei einem Pflichteinsatz im Ruderboot von der starken Strömung abgetrieben wurde und vergeblich versuchte, seine Strafkolonie wiederzufinden. Gerne hätte ich weitergelesen. Karls Bücherregal quillt über. Auf den stehend einsortierten Büchern liegen weitere Bücher quer. Auf dem obersten Regalboden sind die Bücher so hoch gestapelt, dass sie wie Mauerwerk aussehen. Das Regal neigt sich beunruhigend nach vorn in den Raum, da der Fußboden ausgetreten ist und zur Wand hin abschüssig ausläuft. Karl hat eine ganze Sammlung mit Büchern von und über Clowns. Ich griff mir einen Band „On Clowning“ mit vielen Bildbeispielen. Die darin abgebildeten Clowns trugen immer quer gestreifte Oberteile und Hosenträger. Am schönsten fand ich die Bildtafeln, auf denen zwei Variationen einer komischen Handlung gezeigt wurden. Darunter stand einmal „right“ und einmal „wrong“.
Sonntag, 28. Mai
Letzter Eintrag, bevor ich Karls Wohnung verlasse. Ich habe gut geschlafen und fühle mich ausgeruht für den Tag. Heute soll es wieder heiß und trocken werden, also keine Not. Ich werde nicht hier frühstücken. Ich werde auch heute Abend nicht mehr hier her zurückkommen. Vor allem aber werde ich die südliche Mitte in der Gegend um die Annenstraße meiden. Mir fallen einige Leute ein, die mich jederzeit aufnehmen würden. Die Rolle des Gastes ist undankbar. Aber wenn es darauf ankommt, kann ich mich zusammenrollen wie ein Hund. Dann ist der kleine Kreis, der von meiner Schnauze auf der einen und meinen Hinterbeinen auf der anderen Seite begrenzt wird, das einzige Stück Welt, das mich noch etwas angeht. Vorerst mache ich mir keine Sorgen.
Veit Sprenger (* 1967), director, author and producer, studied music in Hannover, medicine in Frankfurt a.M. and applied theatre science in Gießen. He is co-founder of the theatre company Showcase Beat Le Mot. With this company he produces theatre pieces, performances, art festivals and music videos on an international scale. He co-curated the festival "artgenda" for young baltic art and was a jury-member in numerous contexts such as theatre festivals "unart", "Impulse" and "Westwind". He has been teaching in art academies in Berlin, Hamburg, Lübeck, Gießen, Zürich, Köln, Oslo, Stuttgart and Bern and directing among others at Residenztheater Munich, National Theatre of Macedonia and Von Krahl Theater Tallinn. In 2005 he published his book "Despoten auf der Bühne – Die Inszenierung von Macht und ihre Abstürze". Lately he has also worked in the domain of children's theatre, among others with the price winning pieces "Ragga Hotzenplotz" (Impulse-Preis des Goethe-Instituts) and "Animal Farm" (JugendStückePreis 2014). In 2016 he staged his piece "Enter the Hydra" in the frame of the Berlin Heiner Müller Festival in Hebbel Theatre (HAU1).
#1 January 1st - 8th Jacob Wren
#2 January 9th - 15th Toshiki Okada – japanese version
#3 January 16th - 22nd Nicoleta Esinencu – romanian version
#4 January 20th - 30th Alexander Karschnia & Noah Fischer
#5 January 30th - February 6th Ariel Efraim Ashbel
#6 February 6th - 12th Laila Soliman
#7 February 13th - 19th Frank Heuel – german version
#9 February 26th - March 5th Gina Moxley
#10 March 6th - 12th Geoffroy de Lagasnerie – version française
#11 March 13th - 19th Agnieszka Jakimiak
#12 March 20th - 26th Yana Thönnes
#13 March 30th - April 2nd Geert Lovink
#14 April 3rd - 9th Monika Klengel – german version
#15 April 10th - 16th Iggy Lond Malmborg
#16 April 17th - 23rd Verena Meis – german version
#17 April 24th - 30th Jeton Neziraj
#20 May 15th - 21st Bojan Jablanovec
#21 May 22nd - 28th Veit Sprenger – german version
#22 May 29th - June 4th Segun Adefila
#23 June 5th - 11th Agata Siniarska
#25 June 19th - 25th Friederike Kretzen – german version
#26 June 26th - July 2nd Sahar Rahimi
#27 July 3rd - 9th Laura Naumann – german version
#28 July 10th - 16th Tom Mustroph – german version
#29 July 17th - 23rd Maria Sideri
#30 July 24th - 30th Joachim Brodin
#33 August 14th - 20th Amado Alfadni
#35 August 28th - September 3rd Katja Grawinkel-Claassen – german version
#38 September 18th - 24th Marcus Steinweg
#43 October 23rd - 29th Jeannette Mohr
#44 May/December Etel Adnan
#45 December 24th - 31st Bini Adamczak
#21 May 22nd - 28th Veit Sprenger – german version
10.6. #future politics No3 Not about us Without us FFT Juta
Geoffroy de Lagasnerie Die Kunst der Revolte
21.1. #future politics No1 Speak TRUTH to POWER FFT Juta
Mark Fisher
We are deeply saddened by the devastating news that Mark Fisher died on January 13th. He first visited the FFT in 2014 with his lecture „The Privatisation of Stress“ about how neoliberalism deliberately cultivated collective depression. Later in the year he returned with a video-lecture about „Reoccupying the Mainstream" in the frame of the symposium „Sichtungen III“ in which he talks about how to overcome the ideology of capitalist realism and start thinking about a new positive political project: „If we want to combat capitalist realism then we need to be able to articulate, to project an alternative realism.“ We were talking about further collaboration with him last year but it did not work out because Mark wasn’t well. His books „Capitalist Realism“ and „The Ghosts of my Life. Writings on Depression, Hauntology and Lost Future“ will continue to be a very important inspiration for our work.
Podiumsgespräch im Rahmen der Veranstaltung "Die Ästhetik des Widerstands - Zum 100. Geburtstag von Peter Weiss"
A Collective Chronicle of Thoughts and Observations ist ein Projekt im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.